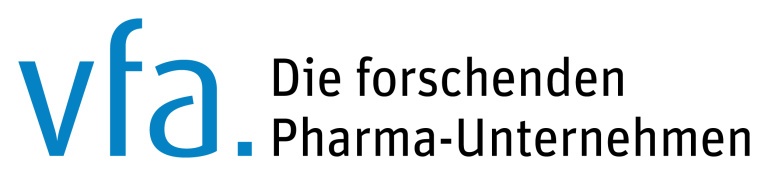Innovationspapier zur Förderung des Gesundheitsforschungs- und Wirtschaftsstandorts
Um die Herausforderungen zu meistern und den Standort Deutschland zukunftsfähig zu gestalten, ist ein deutlich intensiverer Transfer von Forschungsergebnissen in eine wirtschaftlich nachhaltige Anwendung unerlässlich. Dieses Positionspapier zeigt Wege für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen akademischer Forschung und Industrie auf. Es hält nicht bei einer Zustandsbeschreibung an, sondern zeigt konkrete Handlungsempfehlungen für die Au flösung der Hemmnisse im Translations- und Transformationsprozess auf, um die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren nicht nur zu fördern, sondern real werden zu lassen.
Gute Forschung findet sowohl in öffentlichen als auch privaten Einrichtungen in Deutschland statt. Ziel muss es sein, Forschungserkenntnisse schneller und zielgerichteter in die Entwicklung und Versorgung zu bringen, um mittel- bis langfristig eine bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige Patientenversorgung sicherzustellen, die die Potentiale einer zunehmend individualisierten Behandlung nutzt. Gleichzeitig kann dadurch Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit in einer globalisierten Gesundheitswirtschaft gestärkt werden, die sich dann wiederum in zukunftsträchtigen Arbeitsplätzen und somit auch positiv auf die Sozialsysteme auswirkt.
Die Initiatoren dieses Aufrufs sind sich bewusst, dass Innovationen, die zum Wohle der Patientinnen und Patienten in die Versorgung gebracht werden, aufgrund der Kassenlage nicht unabhängig von einer nachhaltigen Finanzierbarkeit gedacht werden können. Die begleitende wissenschaftliche Evaluierung einer prozessoptimierten Versorgung bei der Einführung von Innovationen (,Implementierungsforschung‘) benötigt daher (ebenfalls) präzise, qualitativ hochwertige und kuratierte Daten aus dem Versorgungsgeschehen bezüglich anerkannter validierter Endpunkte.
Ein auf Transparenz, Schnelligkeit und Datenqualität beruhendes System, das auf modernster Infrastruktur und konkreten Zielvorstellungen aufgebaut ist, kann Innovationen und Investitionen fördern. Leitgedanke ist dabei ein Ende-zu-Ende-gedachtes, dateninformiertes Forschungs- und Versorgungssystem im Gesundheitswesen.
I. Beschleunigung des Wissenstransfers – von der Forschung zur Anwendung im Markt
Die Schnittstelle zwischen Forschung und Entwicklung stellt einen kritischen Erfolgsfaktor für Innovationen in Deutschland dar. Um den Transfer von Forschungsergebnissen in marktreife Produkte und Dienstleistungen zu realisieren und zu beschleunigen, bedarf es einer intensiveren und wertschätzenden Zusammenarbeit zwischen akademischer Forschung und Industrie. Im Folgenden werden konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, um diese Schnittstelle zu stärken und den Wissenstransfer zu optimieren:
1. Stärkung von Kooperationsstrukturen
Gemeinsame Forschungsprojekte
Förderung von Public-Private-Partnership-Projekten (PPP) und gemeinsamen Forschungsprojekten, um Synergien zu nutzen und Risiken zu teilen, unter besonderer Berücksichtigung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU).
Virtuelle Forschungslabore
Einrichtung rechtskonformer und EHDS-kompatibler digitaler Plattformen, die den Austausch von Daten, Wissen und Ressourcen zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen ermöglichen.
Register und Biobanken
Förderung von akademisch geführten Registern und Biobanken, (wenn zu de finierende Kriterien und Zerti fizierungen erfüllt sind) – mit Zugang auch für die Industrie.
Früher ansetzen
Viele Innovationen enden in Deutschland im “Death Valley of Translation”, bevor sie einen Reifegrad erreichen, der einen Transfer für die Industrie reizvoll macht. Wirtschaft und Politik sollten zusammen mit Forschenden Translationszentren aufbauen, um die Translation zu verbessern.
2. Finanzierungsinstrumente
Privates Risikokapital
Ausbau von Risikokapitalfonds, die sich auf Frühphasen finanzierungen für technologiebasierte Unternehmen spezialisieren.
Steuerliche Anreize
Schaffung steuerlicher Anreize für Unternehmen, die in Forschung und Entwicklung investieren.
Öffentliche Förderprogramme
Gezielte Nutzung und ggf. Ausweitung von Förderprogrammen für den Technologietransfer, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU); Förderung sollte dabei nicht zeitlich, räumlich oder auf eine Indikation begrenzt sein.
Anwendungspatente für seltene Erkrankungen
3. Förderung von Entrepreneurship
Entrepreneurship-Ausbildung
Integration von Entrepreneurship-Kompetenzen in die Ausbildung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.
Mentoring-Programme
Einrichtung von spezi fischen Mentoring-Programmen, um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei der Gründung von Unternehmen und dem Schutz ihres geistigen Eigentums zu unterstützen.
Gründungskultur
Schaffung einer lebendigen Gründungs- und Start-up-Kultur an Hochschulen und Forschungseinrichtungen (z. B. Wettbewerbe und Austauschprogramme zwischen akademischer Forschung und Industrie, Best-Practice-Sharing).
Inkubatoren und Acceleratoren
Ausbau und Vernetzung von Inkubatoren und Acceleratoren, die ausgegründete junge Unternehmen bei ihrer Entwicklung begleiten und unterstützen; wirksame Kommunikationsmaßnahmen zwecks Bekanntmachung dieser Strukturen.
4. Schutz geistigen Eigentums
Bewusstsein für Schutz geistigen Eigentums
Reguläre Vermittlung von Basiswissen zum Thema notwendige Sicherung von Forschungsergebnissen in der Ausbildung von Wissenschaftlern an Hochschulen und weiteren Einrichtungen. Stärkung der akademischen Intellectual-Property-Einrichtungen.
Vereinfachte Patentanmeldung
Vereinfachung der Patentanmeldeverfahren für Forschungseinrichtungen und Start-ups, Zulassung von Indikationspatenten/Anwendungspatenten für seltene Erkrankungen.
Lizenzierung
Entwicklung flexibler Lizenzmodelle, um die Verwertung von Forschungsergebnissen zu erleichtern.
5. Stärkung der Netzwerke
Branchentre ffen und Konferenzen
Regelmäßige Veranstaltungen/Austauschformate zur Vernetzung von Wissenschaftlern und Unternehmern mit politischer Unterstützung (Bsp. Länderministerien), auch zur Eruierung forschungsrelevanter Bedarfe von Unternehmen unter Einbezug von Patientinnen und Patienten.
Ideenbörsen für neue Wirkprinzipien und Technologien
Digitale Infrastruktur
Gewährleistung einer leistungsstarken und sicheren IT-Dateninfrastruktur zwecks Nutzung von innovativen digitalen Technologien wie Anwendungen von KI.
Kooperationen mit Technologieparks
Ausbau der Zusammenarbeit mit Technologieparks, die unter Einbezug von Forschenden errichtet werden, um von der räumlichen Nähe zwischen Forschung und Wirtschaft zu pro fitieren.
Regionale Cluster
Branchenspezi fische regionale Cluster haben ein Interesse an der Entwicklung ihres Umfeldes zu führenden Life-Science-Standorten mit internationaler Strahlkraft. Mit den jeweiligen Netzwerken, die zum Beispiel Kompetenzvermittlung in einschlägigen Bereichen vorantreiben, fördern sie die Innovationskraft in den Clustern.
II. Karrierepfade durchlässig gestalten: wissenschaftliches und unternehmerisches Mindset bei Forschenden fördern und fordern
Beide Seiten zu kennen, fördert die Zusammenarbeit und das gegenseitige Verständnis. Daher sollte die Karriere nicht eingleisig verlaufen, sondern von Durchlässigkeit sowohl im Studium durch Praktika wie auch in späteren Berufsjahren geprägt sein. Dem können Praktika und Ausgleiche in den Versorgungssystemen dienen.
1. Einblicke in Forschungsaktivitäten der Privatwirtschaft
Unternehmenspraktika
Forschenden wird neben ihren akademischen Karrierewegen ermöglicht, durch „Side-Steps“ Eindrücke von der Arbeit in Unternehmen zu erhalten. So sollten forschende Unternehmen projekt- und zeitbezogen Beschäftigungskonzepte für den akademischen Nachwuchs aufsetzen können, die in deren Laufbahn als relevanter Wissenszuwachs anerkannt werden.
Short/Long Term Assignments (STA/LTA)
Forschungsaufenthalte in der privaten Wirtschaft sollen garantiert als Leistungsbestandteil an Hochschulen anerkannt werden. Zudem erfolgt eine strukturierte (Wieder-)Eingliederung der Forschenden nach diesen STA/LTA.
Flexibles Beschäftigungsumfeld
Um das gegenseitige Verständnis für die jeweilige Kultur und die Notwendigkeiten in der wissenschaftlichen und unternehmerischen Umgebung zu entwickeln, ist die Konzeption eines flexiblen Umfeldes sinnvoll. Ein Beispiel dafür ist die Arbeit in Public-Private-Partnership-Projekten. Neben der Arbeit in Grundlagenforschung, klinischer Entwicklung und Versorgungsforschung im Hochschulsetting, erhalten Forschende frühzeitig Einblicke in industrienahe Forschung und Entwicklung. Zudem sollten Maßnahmen ergriffen werden, die den Wechsel z. B. von Beamten zu CEOs von Start-ups beamtenrechtlich ermöglichen, ohne Pensionsansprüche zu verlieren.
2. Beratungsstellen an wissenschaftlichen Einrichtungen
An Hochschulen und Forschungseinrichtungen werden verp flichtend Anlaufstellen eingerichtet, die die individuelle Bereitschaft von Interessenten und erste Schritte zur Ausgründung unterstützen. Die Beratungsstellen der Hochschulen und Universitäten unterstützen und fördern zudem die Patentierung von Forschungsergebnissen und vermitteln konkrete Schritte zu einer zügigen Weiterentwicklung in Produkte und Dienstleistungen. Zudem beraten sie bezüglich Public-Private-Partnerships.
3. Berücksichtigung von Leistungen
Erfolge in der Ausgründung sollten Eingang in die Leistungsbeurteilung im akademischen Umfeld finden. Insbesondere Hochschulrankings können erfolgreiche Ausgründungen an den jeweiligen Universitäten berücksichtigen, denn erfolgreiche Wissenschaft misst sich nicht nur an der Zahl der Publikationen oder der Einwerbung von Drittmitteln, sondern am „Impact“, etwa der Zahl erfolgreicher Ausgründungen. Es geht auch darum, Forschende aus aller Welt für den Forschungsstandort Deutschland zu begeistern.
III. Regulative Rahmenbedingungen innovationsfreundlich gestalten
Zielgerichtet unterstützende regulative Rahmenbedingungen sind essenziell, um sowohl Arbeitsbedingungen in akademischer Forschung und Wirtschaft motivierend gestalten zu können als auch innovative Produkte zu entwickeln und erfolgreich und skalierbar zu vermarkten.
1. Weiterentwicklung der Datennutzungsbestimmungen im Gesundheitswesen
Datenstandards
Die Regulatorik des deutschen Gesundheitswesens setzt national de finierte Datenstandards vor international anerkannte. Das bedeutet insbesondere für länderübergreifende Projekte einen hohen zusätzlichen Arbeitsaufwand, um vergleichbare Daten bearbeiten zu können. Im Hinblick auf den anstehenden Aufbau des European Health Data Space (EHDS) als „Daten-Binnenmarkt“ ist diese Situation nicht haltbar. International anerkannte Datenstandards sind eine zwingende Notwendigkeit und müssen stets vorrangig eingesetzt werden.
Vereinheitlichung der Datenschutzregelungen
In Deutschland gelten zusätzlich zur verbindlichen EU-weiten DS-GVO zahlreiche weitere Gesetze bezüglich der Nutzung von Gesundheitsdaten auf verschiedenen Ebenen. Im Gesundheitswesen sind hier vor allem die Landeskrankenhausgesetze mit jeweils eigenen, teilweise widersprüchlichen und oft über die DSGVO hinausgehenden Regelungen zur Datenverarbeitung zu nennen. Das GDNG war ein Schritt in die richtige Richtung, greift jedoch noch nicht weit genug, um alle Hemmnisse für Forschung in Deutschland zu beseitigen, ein Forschungsdatengesetz fehlt leider weiterhin. Im internationalen Wettbewerb fällt Deutschland u. a. aus diesem Grund im Ranking der Durchführung klinischer Studien zurück, weil Anforderungen nicht-einheitlich und zusätzlich zur DS-GVO sind. Insbesondere auf Ebene der Landeskrankenhausgesetze erscheint deshalb eine Harmonisierung notwendig, um Datenverarbeitungsprozesse deutlich schneller und effektiver durchführen zu können.
Etablierung von Reallaboren
Um Transfer und Translation von Forschungsergebnissen vor der Beantragung von Zulassungen und der Vermarktung unter realistischen Bedingungen testen und anpassen zu können, sind „Sandboxes“ eine effektive Maßnahme.
Weiterentwicklung der elektronischen Gesundheitsakte zum Gesundheitsdatenökosystem
Die „ePA für alle“ ist ein großer Fortschritt und in Verbindung mit dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz und dem EHDS eine gute Datengrundlage für künftige Datennutzungsprojekte. Es ist nachvollziehbar, dass im ersten Schritt ein dokumentenbasiertes System aufgebaut wird. In der weiteren Entwicklung muss das Ziel eines Gesundheitsdatenökosystems mit digital verfügbaren, strukturiert erfassten und interoperablen Daten präsent bleiben, denn erst dann werden die verfügbaren Daten überhaupt für Forschungszwecke nutzbar sein.
2. Marktzugang für innovative Produkte
Datenverarbeitung von Behandlungsdaten
Beim Einsatz moderner, digital-basierter Medizintechnologie entstehen zahlreiche Daten, deren Verarbeitung und Nutzung regulatorisch kompliziert ausgestaltet ist. Ein Produkt, das in verschiedenen Bundesländern zum Einsatz kommt, muss jeweils vor dem Hintergrund der dortigen Regeln der Datenverarbeitung im Krankenhaus neu geprüft werden. Diesbezügliche Vereinfachung und Klarstellung wird den Einsatz von innovativer – neu entwickelter – Technik beschleunigen, effizienter und attraktiv machen.
Eine nachvollziehbare Neuregelung des Nachweisverfahrens der Gleichwertigkeit einer Methode
Die Regeln für den Zugang von neuen Methoden bzw. Verfahren auf den Markt der Gesetzlichen Krankenversicherung sind sehr eng gefasst. Sie zielen auf den Nachweis von medizinischem Nutzen mit „harten“ patientenbezogenen Endpunkten ab. Digitale Möglichkeiten können heute durch Simulation auf Grundlage vorhandener Daten etablierte, invasivere Methoden ersetzen. Sie sind dabei nicht besser, erreichen das gesteckte Ziel lediglich mit anderen, idealerweise ef fizienteren Mitteln. Die gewöhnlich zu erbringenden Nutzennachweise stellen bisher eine hohe Markteintrittshürde dar, die neue Methoden im Ergebnis verteuern und verzögern. Dies führt zudem dazu, dass veraltete Methoden in der Versorgung keinem Wettbewerb ausgesetzt werden.
Einführung eines Ermöglichungsprinzips
Aufgrund einer zu sehr auf Sicherheit ausgerichteten Bewertungspraxis von Forschungsvorhaben werden von den Antragstellenden Daten abgefragt, die über die Erfordernisse anderer EU-Mitgliedstaaten hinausgehen und für Start-ups und KMU kaum zu stemmen sind. Oft sind dann andere EU-Mitgliedsstaaten Ausweichländer. Die Etablierung einer Ermöglichungsmentalität wäre geeignet, den Standort Deutschland beträchtlich zu stärken.
3. Einheitliche Interpretation und Umsetzung von EU-Verordnungen
Ausrollen der regulativen Rahmenbedingungen über alle Mitgliedsstaaten hinweg
Die EU regelt in allen genannten Bereichen mit Verordnungen und Durchführungsakten die Bedingungen des EU-Binnenmarkts. Diese große Errungenschaft könnte für einheitliche Bedingungen über die 27 Mitgliedstaaten hinweg sorgen und damit insbesondere Start-ups und KMU Chancen für die Entwicklung und Vermarktung innovativer Produkte und Lösungen bieten. Die damit einhergehende Klarheit in der Regulierung bietet Rechtssicherheit. Jegliche nationale Verschärfung über die eigentliche Verordnung hinaus macht diesen Vorteil zunichte. Junge Unternehmen haben nicht die Ressourcen für Recherche und jeweils spezi fische Prozesse zur Erfüllung der Au flagen und können diese auch kostenseitig nicht stemmen. Nationalstaatliches „Gold-Plating“ sorgt für Verlangsamung und Verteuerung von Forschungs-, Entwicklungs- und Vermarktungsprozessen. Nur einheitliche Regelungen im gemeinsamen EU-Binnenmarkt bieten einen entscheidenden Vorteil für Innovation und Translation.
Harmonisierung von vertikalen und horizontalen gesetzlichen Rahmenbedingungen im Bereich Gesundheit
Das notwendige Zusammendenken von Gesetzen kann am Beispiel KI-Anwendungen im Gesundheitsbereich nachvollzogen werden. Die stetige Ausweitung der Nutzung und Akzeptanz von KI-Anwendungen muss vorankommen. Notwendige Basis dafür ist ein harmonisiertes Konformitätsbewertungsverfahren für KI-Systeme im Einklang mit der schon bestehenden Medical Device Regulation (VO 2017/745; MDR), welches bürokratische Mehrbelastung, Kapazitätsengpässe und zusätzliche Kosten durch den AI Act vermeidet.
Fazit
Wenn Forschung, Versorgung und nachhaltige Finanzierbarkeit datengestützt zusammengedacht werden, ist dies ein Gewinn für die Gesundheitsversorgung und den Wirtschaftsstandort Deutschland.
Durch Forschung neu entwickelte Produkte und Lösungen sollen die Gesundheitsversorgung der Menschen in unserem Land besser machen. Zunehmend können Produkte basierend auf Datennutzung bedarfsgerecht und gezielt in bestimmten Krankheitssituationen zum Einsatz kommen. Das führt zu besseren Behandlungsergebnissen und zu einem Ressourcen-sparenden Einsatz. Dies gilt es in den Fokus zu nehmen.
Die Aufgabe, die richtigen regulativen und praktischen Schritte auf den Weg zu bringen, ist sehr groß. Als beteiligte Verbände und Institutionen unterbreiten wir deshalb das Angebot zu kooperativer Zusammenarbeit, in der wir gern unsere Kräfte und Ideen einbringen und gemeinsam mit anderen Beteiligten die zielgerichtete Umsetzung planen und koordinieren.