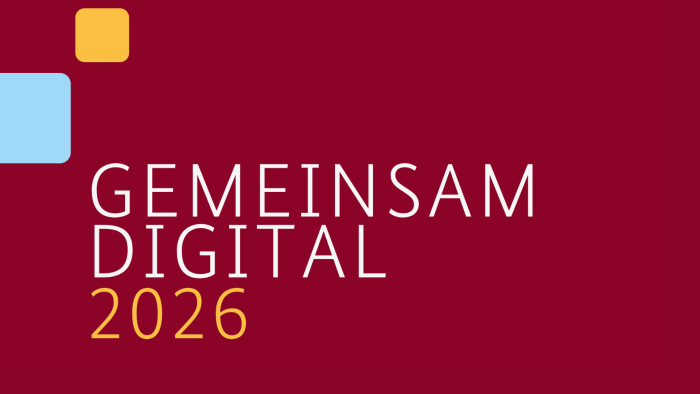"Das Gesamtkonzept muss stimmen"

Dr. Rainer Röhrig, Thomas Norgall © TMF e.V.
Die technikgestützte Erfassung von Vitaldaten in den eigenen vier Wänden, medizinische Smartphone-Apps und andere Services setzen sich immer mehr durch. Die diesjährige TELEMED, die am 19. Oktober 2011 in Berlin stattfindet, widmet sich deshalb dem Thema „Telemedizin im privaten Raum – Perspektiven für IT-gestützte Services am 3. Gesundheitsstandort“. Dr. Rainer Röhrig und Thomas Norgall sind die Vorsitzenden des Programmkomitees der Veranstaltung.
Was verbirgt sich eigentlich hinter den Begriffen „zweiter Gesundheitsmarkt“ und „dritter Gesundheitsstandort“ und welche politische Bedeutung haben sie?
Norgall: Seit einigen Jahren wird das wirtschaftliche Geschehen um privat finanzierte gesundheitsbezogene Produkte und Dienstleistungen als „zweiter Gesundheitsmarkt“ bezeichnet. Die Bürger zeigen eine steigende Bereitschaft, eigene Beiträge zur Förderung und Aufrechterhaltung ihrer Gesundheit zu leisten und entsprechende Verantwortung zu übernehmen. Als „dritter Gesundheitsstandort“ neben Klinik und Arztpraxis etablieren sich weltweit die eigene Wohnung und das private Umfeld, wo laientaugliche medizinische, diagnostische und therapiebegleitende Geräte zusammen mit passenden Informations- und Dienstleistungsangeboten für den privaten Anwender zunehmend zur Verfügung stehen.
Die breite Nutzung dieser Entwicklungen in der Regelversorgung birgt erhebliches qualitatives und ökonomisches Potential, scheiterte in Deutschland aber bislang an fehlenden Modellen zur Finanzierung und Defiziten hinsichtlich Normierung und Ausbau der notwendigen (Telematik-)Infrastruktur.
Röhrig: Die politische Herausforderung ist jetzt, eine Infrastruktur für diese Angebote zu schaffen und im Bereich Verbraucherschutz die Angebote auf ihren Nutzen und ihre Qualität hin zu überwachen.
Es gibt bereits einige als wirtschaftlich sinnvoll anerkannte telemedizinische Services. In welchen Anwendungsfeldern?
Norgall: Für mehrere Indikationen, insbesondere Diabetes, Herzinsuffizienz sowie Wundbehandlung wurde der ökonomische und qualitative Nutzen von Telemonitoring nachgewiesen. Auch für telemedizinische Dienste wie den häuslichen und mobilen Notruf besteht ein hoher Bedarf.
Röhrig: Wenn man es genau nimmt, ist der Hausnotrufdienst der älteste und erfolgreichste telemedizinische Service in Deutschland. An diesem Dienst kann man viel lernen:
- Die Technik muss gerade im häuslichen Umfeld einfach, sicher und beherrschbar sein.
- Der Wert des Services liegt nicht allein in der Technik – das Gesamtkonzept muss stimmen. Ohne Leitstelle und mobile Helfer zum Türöffnen hätte sich der Hausnotrufdienst niemals durchgesetzt.
Telematik- und Medizintechnik-Experten fordern eine stärkere Koordination der neuen Angebote und einheitliche technische Standards. Was soll damit verhindert bzw. erreicht werden?
Norgall: Heutige Komponenten und Systeme für den „dritten Gesundheitsstandort“ sind meist Insellösungen, die wegen proprietärer Schnittstellen nur schwer über Herstellergrenzen hinweg erweitert beziehungsweise mit anderen Systemen und Infrastrukturen des Gesundheitswesens verknüpft werden können. Lebenssituation und Betreuungsbeziehungen kranker und älterer Menschen ändern sich aber laufend, Monitoring- und Assistenzsysteme müssen deshalb dynamisch veränderbar sein.
Röhrig: Wenn wir den Gedanken des Hausnotrufes im Zeitalter des Mobilfunks weiterdenken: Das Smartphone kann mit EKG (Pulsgurt) und Bewegungsmelder (im Smartphone) die Bewegung eines Menschen überwachen. Wenn eine Notfallsituation identifiziert wird, ist eine einheitliche Übermittlung an die Leitstelle erforderlich. Diese muss die Daten entschlüsseln können, egal von welchem Gerät sie stammen. Hier dürfen regional abweichende Datenstandards keine Hürden bilden.
Auch wenn Sie Daten aus einem implantierten Medizingerät wie zum Beispiel einem Herzschrittmacher oder einer Arzneimittelpumpe zu Ihrem Hausarzt oder Facharzt senden wollen, müssen Medizingerät, Smartphone und Dienstleister austauschbar sein. Dies lässt sich nur über Standards erreichen. Sie sorgen durch einen gesunden Markt für Innovationen und sind die Basis für eine Qualitätssicherung.
Welchen Rahmen setzt das novellierte Medizinproduktegesetz für Telemedizin und AAL-Angebote?
Norgall: Tendenziell steigen die Hürden für den Marktzugang und die Kosten für Produktentwicklung und Dokumentation. Andererseits werden Medizinprodukte aufgrund höherer Anforderungen beispielsweise hinsichtlich der klinischen Bewertung und Prüfung oder der systematischen Behandlung von "schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen" für den Patienten sicherer.
Röhrig: Im Bereich der Telemedizin gibt es durch die Teleradiologie schon lange Erfahrungen mit der Anwendung des Medizinproduktegesetzes. Anders ist es im zweiten Gesundheitsmarkt: Hier fallen Geräte, die weder gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen, nicht unter die Medizinproduktebetreiberverordnung und unterliegen somit nicht den gleichen Regeln der Qualitätssicherung. Hinsichtlich der Ausfallsicherheit, Verfügbarkeit und Fehlertoleranz bei einer Kombination von professionellen Dienstleistern und heterogenen Medizingeräten sind deshalb im zweiten Gesundheitsmarkt noch viele technische, organisatorische und regulatorische Entwicklungen nötig.
Welche Perspektiven für die Vergütung von Telemedizin- und E-Health Leistungen bietet das neue Versorgungsstrukturgesetz?
Röhrig: Das Versorgungsstrukturgesetz bietet die Möglichkeit, ambulante telemedizinische Leistungen in den einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen (EBM) einzubringen. Damit können sinnvolle Projekte, wie zum Beispiel die Überwachung oder Unterstützung im häuslichen Bereich, die heute schon die hausärztliche Versorgung ergänzen, über die Projektphase hinaus verstetigt werden und die Versorgungsqualität für die Patienten dauerhaft verbessern.
Norgall: Unverkennbar soll Telemedizin zur Sicherung flächendeckender, wohnortnaher ambulanter Versorgung explizit gefördert werden. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie, in welchem Umfang und in welchem Zeitraum die bisher in zahlreichen, teilweise konkurrierenden Pilotprojekten und Einzelverträgen erprobten Anwendungen in die Regelversorgung überführt werden können. Dafür ist bei den Akteuren noch eine Menge Überzeugungsarbeit zu leisten.
Herr Dr. Röhrig, Herr Norgall, vielen Dank für das Gespräch!
Dr. med. Rainer Röhrig ist Arzt und Medizininformatiker in der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie am Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Standort Gießen.
Thomas Norgall ist stellvertretender Sprecher der Fraunhofer-Allianz AAL und koordiniert die Fraunhofer-Aktivitäten im Bereich "Personal Health" am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen in Erlangen.