Die Herausforderungen für Biobanken liegen im nachhaltigen Betrieb und in der Vernetzung der Strukturen
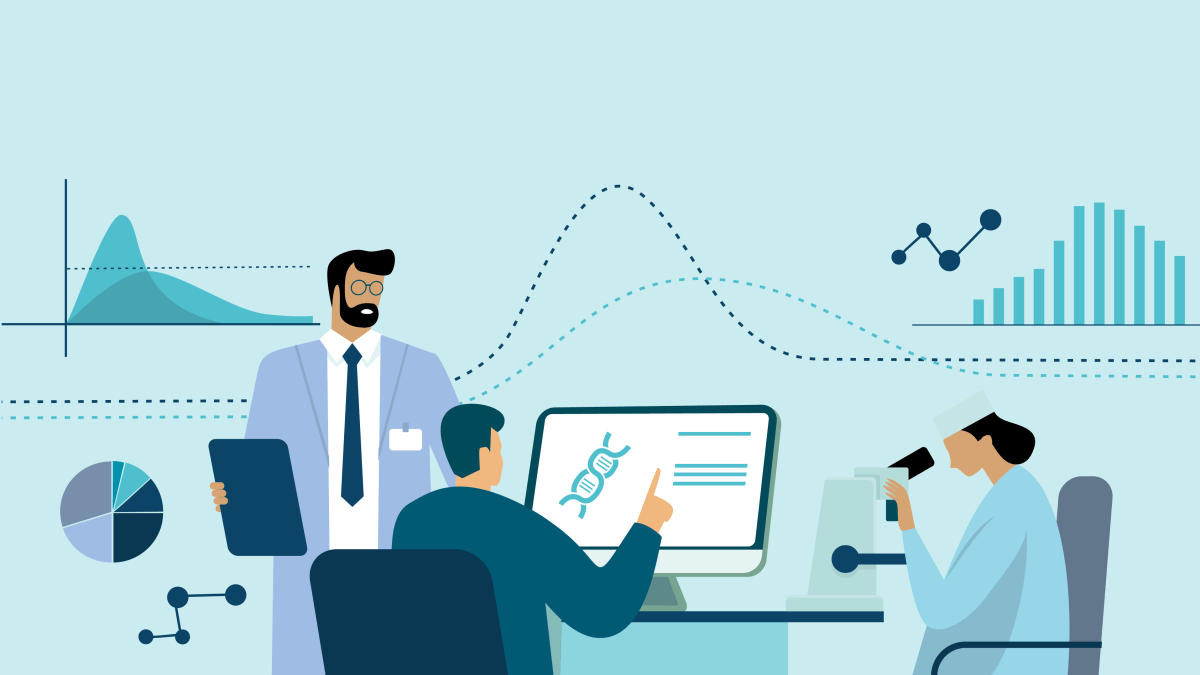
© Zubada - stock.adobe.com
Biobanking in Deutschland hat in den vergangenen Jahren unter anderem durch umfassende Fördermaßnahmen einen großen Aufschwung erfahren. Nachdem gut funktionierende Infrastrukturen etabliert wurden, sei es nun an der Zeit, eine bessere Vernetzung untereinander zu erreichen. Dies betonten führende Experten deutscher Biobanken und Biobanken-Netzwerke beim National Biobanking Day der ISBER-Jahrestagung am 5. April 2016 in Berlin.

Prof. Dr. Michael Krawczak © TMF e.V.
Eine Plattform für Biobanken-Aktivitäten ist seit mittlerweile 12 Jahren die TMF, die den National Biobanking Day in Partnerschaft mit ISBER ausgerichtet hat. „Bedürfnisse und Probleme zu lösen, die in der Forscher-Community entstehen, ist Hauptanliegen der TMF. In den vergangenen Jahren kann sie auf vielfältige Erfolge im Bereich des Biobankings zurückblicken“, sagte Prof. Dr. Michael Krawczak (Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel), Vorsitzender des TMF-Vorstands. Krawczak betonte die Bedeutung der TMF-Arbeitsgruppe Biomaterialbanken für den interdisziplinären Austausch innerhalb der Community. Darüber hinaus habe die TMF durch Aktivitäten wie die Ausrichtung des jährlich stattfindenden Nationalen Biobanken-Symposiums, die Einbindung in BBMRI-ERIC oder die Unterstützung der zentralisierten Biobanken (cBMB) die Biobanken-Community aktiv unterstützt.

Dr. Roman Siddiqui © TMF e.V.
Deutsches Biobanken-Register: Anreize sind notwendig
Eine zentrale Infrastruktur, die die TMF betreibt, ist das Deutsche Biobanken-Register (DBR), das eine öffentlich zugängliche Übersicht über die in Deutschland bestehenden medizinisch relevanten Biobanken gibt. „Ziel des Deutschen Biobanken-Registers ist es, Biobanken sichtbarer und besser nutzbar zu machen“, erklärte Dr. Roman Siddiqui (TMF). „Die Erfahrungen der letzten Jahre haben allerdings gezeigt, dass Anreize notwendig sind, um Forscher dazu zu motivieren, ihre Probenbestände im Biobanken-Register einzutragen“, so Siddiqui. Anreize könnten beispielsweise durch den Gesetzgeber oder Förderer geschaffen werden, indem sie auf die Registrierung im Biobanken-Register bestünden. Die Selbstdarstellung in Registern ist der erste Schritt zur Umstellung vom analogen Datenhandling in die digitale Welt.

Prof. Dr. Peter Schirmacher © TMF e.V.
Biobanken als Scharnier für die translationale Forschung
Ein harmonisiertes Biobanken-Management ist eine der Herausforderungen, vor der die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung (DZG) stehen, erklärte Prof. Dr. Peter Schirmacher (Universitätsklinikum Heidelberg). Die DZG widmen sich der Erforschung von Volkskrankheiten und verfolgen das Ziel, den translationalen Prozess vom Forschungsergebnis zur Anwendung beim Patienten zu verbessern. Die Zentren sind auf eine Vielzahl von Standorten verteilt und darauf angewiesen, vorhandene Kompetenzen über diese Standorte hinweg zu bündeln. Dabei können sie auf eine erfolgreiche Implementierung von Biobanken in den letzten Jahren zurückblicken. Zukünftig sei es laut Schirmacher aber geboten, eine organisatorische und finanzielle Nachhaltigkeit herbeizuführen und die Kooperation untereinander, beispielsweise durch gemeinsame Gremienarbeit, erfolgreich aufrecht zu erhalten.

Prof. Dr. Michael Hummel © TMF e.V.
Biobanken-Netzwerke gewinnen an Bedeutung
„Biobanken sind die zentrale Ressource, um exzellente biomedizinische Forschung zu unterstützen“, hob Prof. Dr. Michael Hummel (Charité − Universitätsmedizin Berlin) hervor. Da eine Biobank allein aber oftmals keine ausreichend großen Probensammlungen bereitstellen könne, sei eine Vernetzung untereinander notwendig. Diese Biobanken-Netzwerke gewinnen als Infrastruktur zunehmend an Bedeutung, so Hummel. Der German Biobank Node (GBN, Deutscher Biobankenknoten), eine zentrale Kontakt- und Vermittlungsstelle für die deutsche Biobanken-Gemeinschaft, richtet sich an alle nationalen Biobanken und Verbundnetzwerke und darüber hinaus an Politik, Presse, Patientenvertreter, Industrie und Förderinstitutionen und koordiniert die deutschen Biobanken-Aktivitäten. Er repräsentiert zugleich Deutschland im europäischen Netzwerk von Biobanken (BBMRI-ERIC).

Prof. Dr. Annette Peters © TMF e.V.
NAKO-Biobank als umfassende epidemiologische Ressource für die Zukunft
Eine groß angelegte populationsbasierte Biobank entsteht zurzeit im Rahmen der NAKO Gesundheitsstudie mit 200.000 angestrebten Probanden. Im Rahmen der Studie werden zwei Drittel der erhobenen Proben zentralisiert aufbewahrt. „Die NAKO Gesundheitsstudie erhebt eine einzigartige Breite von Bioproben, von der auch die Community in Zukunft profitieren können wird. Das macht sie als epidemiologische Ressource äußerst wertvoll“, verdeutlichte Prof. Dr. Annette Peters (Helmholtz Zentrum München).

Prof. Dr. Roland Jahns © TMF e.V.
Mehr Akzeptanz gegenüber Biobanking in Fakultäten und Kliniken
Der Aufschwung in der Biobanken-Landschaft während der letzten Jahre habe auch zu einem Bewusstseinswandel und mehr Akzeptanz in Fakultäten und Kliniken geführt, erklärte Prof. Dr. Roland Jahns (Universitätsklinikum Würzburg) am Beispiel der zentralisierten Biobanken (cBMB). Gleichwohl bleibe noch viel zu tun, beispielsweise eine Nachhaltigkeit der neu und erfolgreich geschaffenen Strukturen sicherzustellen. Auch dies sei nur durch Vernetzung und einer Kommunikation auf dem IT-Level möglich, so Jahns.
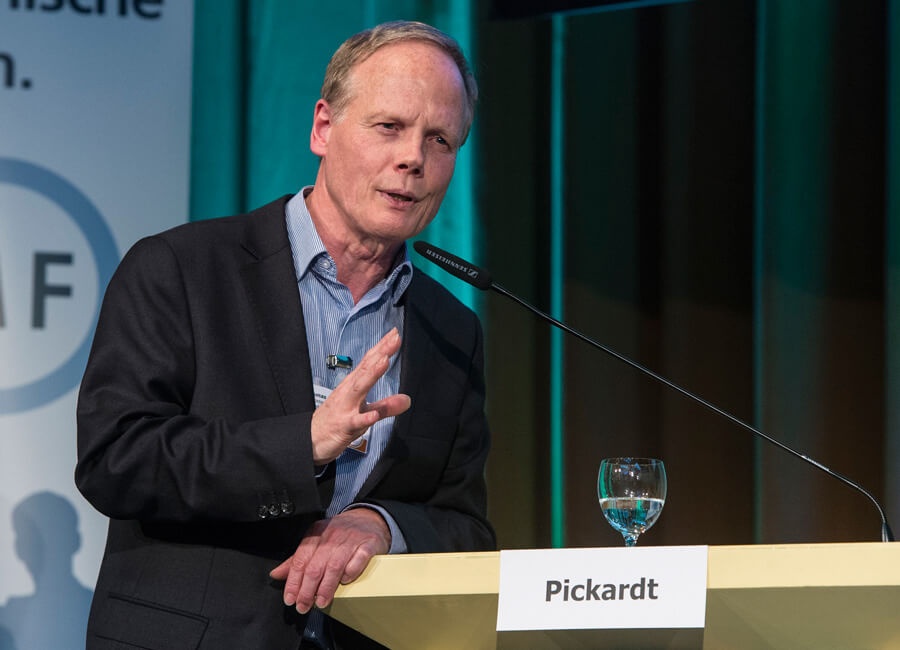
PD Dr. Thomas Pickardt © TMF e.V.
Netzwerkmanagement und Kommunikationsfähigkeit erforderlich
Dass Akzeptanz und Vertrauen neben den hohen technischen, ethischen und rechtlichen Erfordernissen wichtige Faktoren im Umgang mit Bioproben und dem Arbeiten im Netzwerk sind, stellte auch PD Dr. Thomas Pickardt (Kompetenznetz Angeborene Herzfehler) dar. Er beschrieb den Weg der Bioproben, die im Rahmen von Studien für das Kompetenz Angeborene Herzfehler erhoben werden sowie die dazugehörige Netzwerk-Infrastruktur. „Unterschätzen Sie nicht die Anstrengungen, die erforderlich sind, um eine Win-win-Situation für alle Beteiligten zu erreichen. Ein erfolgreiches Netzwerk-Management und Kommunikationsfähigkeit sind unerlässlich“, betonte Pickardt.

PD Dr. Esther Herpel © TMF e.V.
Biobanken profitieren von der Integration in lokale Forschungs- und Versorgungsstrukturen
PD Dr. Esther Herpel (Universitätsklinikum Heidelberg) betonte die Rolle des Biobankings für eine erfolgreiche translationale Krebsforschung und zeigte zentrale Anforderungen an das Biobanking auf. Laut Herpel sollten Biobanken in die bestehenden lokalen Forschungs- und Versorgungsstrukturen integriert werden, um so den Gebrauch von Bioproben effizient zu gestalten, Synergien zu schaffen und Qualitätsstandards sicherzustellen. Gleichzeitig appellierte auch sie an die Teilnehmer der Tagung, an Netzwerken teilzuhaben und zusammenzuarbeiten.

Dr. Helen Moore © TMF e.V.
Die Qualität der Bioproben hat großen Einfluss auf die Qualität der Forschung
Wie evidenzbasiertes Biobanking vorangetrieben werden kann, um auf lange Sicht die Qualität der Forschung zu verbessern, illustrierte Dr. Helen Moore (NIH / National Cancer Institute, USA) in ihrer Keynote. „Die Qualität von biomedizinischer Forschung beruht auch auf der Qualität der Bioproben. Deshalb ist es essentiell, die Prozesse, die mit diesen Bioproben verbunden sind, zu optimieren.“, sagte Moore. Dies erfordere evidenzbasierte Standards, die in Forschung und Versorgung entwickelt und unter den an den Proben teilhabenden Gruppen kommuniziert werden müssten. Aus diesem Grund gebe das National Cancer Insitute seit 2007 einen Best Practice-Leitfaden heraus, der laufend aktualisiert wird. Ziel der Veröffentlichung dieses Leitfadens sei, eine Grundlage für den operativen Umgang mit Bioproben in der Krebsforschung zu bieten und sich damit dem ständig weiterentwickelnden state of the science anzupassen.

Dr. Jim Vaught, ISBER- Vorsitzender 2015-16 © TMF e.V.

V.l.n.r.: Dr. Roman Siddiqui (TMF), Dr. Jim Vaught (ISBER), Sebastian C. Semler (TMF) © TMF e.V.
Der National Biobanking Day war in die Jahrestagung der internationalen Organisation ISBER eingebettet, die in Partnerschaft mit der TMF vom 5. bis 8. April 2016 stattfand. Der ISBER-Vorsitzende Dr. Jim Vaught wies während seiner Eröffnungsrede auf die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen ISBER und der TMF hin, die vor zwei Jahren in Orlando begann und in kurzer Zeit mit der gemeinsamen Austragung der ISBER-Jahrestagung 2016 wertvolle Früchte getragen habe.
Der National Biobanking Day traf mit mehr als 160 Teilnehmern beim internationalen Publikum der ISBER-Tagung auf große Resonanz.
Impressionen

© TMF e.V.

© TMF e.V.

© TMF e.V.
Downloads der Vorträge während des ISBER National Day 2016
| Anhang | Size |
|---|---|
| Prof. Dr. Michael Krawczak - TMF −12 Years a Platform for Biobanking in Germany | 1.33 MB |


