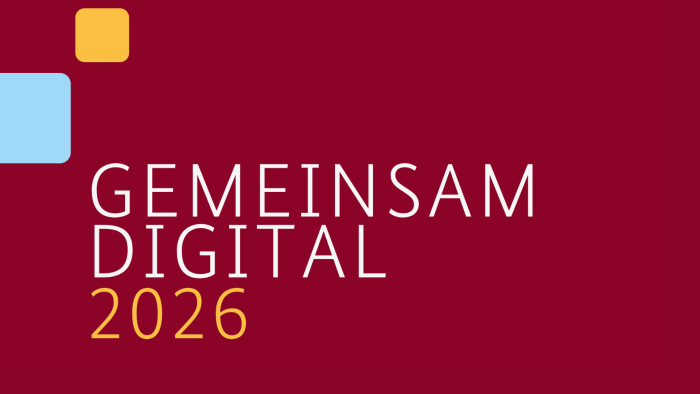Noch viele offene Baustellen im eMeldewesen
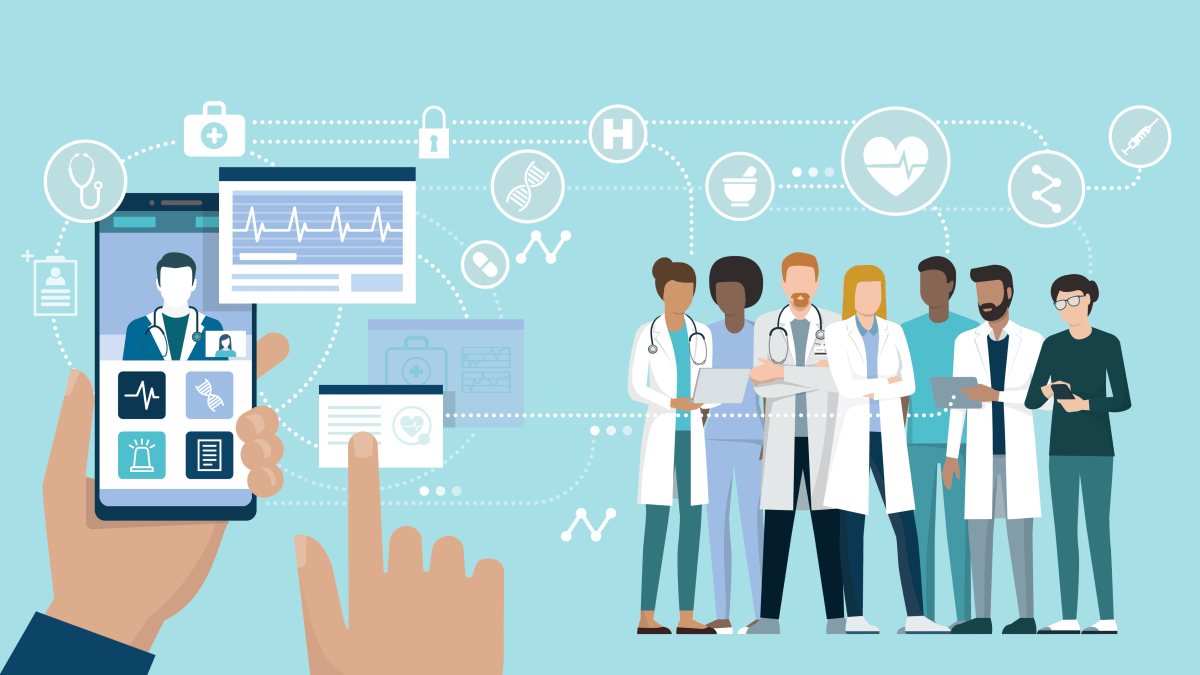
© elenabsl - stock.adobe.com
Die elektronische Erfassung, Übermittlung und Verarbeitung von Daten zu gefährlichen Krankheiten bietet viele Chancen, allerdings sind im elektronischen Meldewesen auch noch zahlreiche Hürden zu überwinden. Für die Ärzte, die zur Meldung gesetzlich verpflichtet sind, muss die Meldung auf jeden Fall deutlich vereinfacht und wo immer möglich automatisiert werden.
Bei der Optimierung von Meldewegen, dem Einsatz von Datenstandards und der wissenschaftlichen Nutzung bestehender Datensammlungen zu meldepflichtigen Krankheiten gibt es in Deutschland noch viele offene Fragen. Dies zeigte der Workshop „ElektronischesMeldewesen“ der Nationalen Forschungsplattform für Zoonosen, der unter der organisatorischen Leitung ihres Standorts bei der TMF am 1. und 2. Juli in Berlin stattfand und der Anlass für das aktuelle Interview der TMF bot.
Wo laufen in Deutschland die Daten über meldepflichtige Krankheiten zusammen, wofür braucht man diese Daten und warum nimmt die Bedeutung des eMeldewesens nicht nur am RKI immer mehr zu?
Krause: Labore, Arztpraxen und Krankenhäuser melden an das örtliche Gesundheitsamt, damit dieses gegebenenfalls sofort Infektionsschutzmaßnahmen einleiten kann. Das Gesundheitsamt übermittelt die geprüften Meldungen über die Landesstellen an das RKI, wo zum einen überregionale Veränderungen aufgedeckt werden, die auf örtlicher Ebene nicht als Ausbruch erkannt werden können. Außerdem überprüft das RKI auf nationaler Ebene, ob Präventionsmaßnahmen (z.B. Wirksamkeit des Pandemieimpfstoffes) und Eindämmungsmaßnahmen (z.B. Wirksamkeit des Rückrufes kontaminierter Lebensmittel) erfolgreich sind oder angepasst werden müssen. Weiterhin werden die Daten wissenschaftlich ausgewertet, um langfristige Trends zu erfassen und bezüglich der Erreger klinische und epidemiologische Eigenschaften zu untersuchen, die z.B. für Therapie- oder Impfempfehlungen benötigt werden. Für diese Aufgaben ist es notwendig, dass die Daten zeitnah, vollständig und korrekt erfasst und übermittelt werden. Alle drei Anforderungen lassen sich durch elektronische Meldewege besser und letztlich wohl auch kostengünstiger erreichen.
Wie ist das Meldeverhalten von Ärzten und Laboren – kommen diese ihren gesetzlich vorgeschriebenen Meldepflichten zuverlässig nach? Worin bestehen Hürden?
Krause: Wir wissen, dass es abhängig von den Krankheiten jeweils eine unterschiedlich hohe Untererfassung gibt. Zum Teil bedingt durch Unwissen mancher Ärzte und Laborleiter über die Meldepflicht, aber zum Teil auch durch die mangelnde Bereitschaft, weil der Meldevorgang als administrative Belastung empfunden wird. An beiden Punkten kann eine elektronische Meldung eine deutliche Verbesserung erzielen. Aber auch für die Gesundheitsämter kann der Bearbeitungsaufwand gesenkt und die Datenqualität verbessert werden.
Im Rahmen des IT-Gipfels der Kanzlerin im Dezember 2009 hat das RKI eine Pilotanwendung zur Anbindung von Laborsoftware an den elektronischen Meldeprozess vorgestellt, die im Rahmen des Pilotprojekts „eISM“ entwickelt wurde. Welche Erfahrungen haben Sie mit der Pilotanwendung gemacht und wie weit sind Sie mit der Realisierung weiterer Ausbaustufen?
Krause: Die Pilotanwendung ist noch in einem Vor-Test-Stadium, so dass hierzu noch keine Aussagen getroffen werden können.
Das DIMDI engagiert sich national und international für den Einsatz von Datenstandards. Worin liegen die großen Herausforderungen, damit Standards wirklich eingesetzt werden?
Thun: Der effiziente elektronische Datenaustausch im Gesundheitswesen kann nur mit einheitlichen IT-Vorgaben umgesetzt werden. Das DIMDI arbeitet im Rahmen der ihm übertragenen Aufgaben eng mit den zuständigen Organisationen, wie der Weltgesundheitsorganisation, europäischen Behörden, der Internationalen Standardisierungsorganisation (ISO) sowie mit den deutschen Standardisierungsorganisationen Health Level Seven (HL7) und dem Deutschen Institut für Normung (DIN) zusammen. Expertinnen des DIMDI leiten dort diverse Arbeitsgruppen.
Der Einsatz von IT-Standards im Gesundheitswesen ist eine große Herausforderung für eHealth–Anwendungen, da sehr viele Institutionen, Organisationen und die Industrie verschiedene Inhalte und Regeln für teils sehr ähnliche Datenelemente wie Diagnosen oder Laborwerte vorgeben. Bundeseinheitliche Vorgaben, basierend auf internationalen Arbeiten, können dem entgegenwirken.
Als Vorbild könnte hier die Rolle des DIMDI bei der Diagnosenklassifikation ICD-10 dienen. Hier wird seit Jahren ein internationaler Standard als Grundlage für zahlreiche Anwendungen in Deutschland, z.B. im Bereich der Abrechnung oder bei der Todesursachenkodierung, erfolgreich eingesetzt und weiterentwickelt.
Darüber hinaus müssen aber zahlreiche weitere technische und medizinisch-inhaltliche Standards für Meldeverfahren vorgegeben werden. Eine zentrale koordinierende Stelle für diese Aufgaben gibt es in Deutschland derzeit nicht. Für den bisher unzureichenden Einsatz von Standards gibt es zahlreiche Gründe. Besonders hervorzuheben sind aus meiner Sicht:
a) IT-Standards sind nicht verfügbar bzw. anwendbar
Standards müssen den prioritären Anwendungen entsprechend entwickelt werden. Internationale Standards sollen dabei an die nationalen Vorgaben angepasst und deutsche Vorgaben internationalisiert werden. Deutsche Experten müssen an dem internationalen Prozess der Standardentwicklung verstärkt mitwirken. IT-Standards sollen implementiert werden. Software- und Schnittstellentests, wie sie Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) seit vielen Jahren als connect-a-thon mit Industrie und Anwendern veranstaltet, prüfen Standards auf Praktikabilität. Eine zentrale Stelle in Deutschland muss IT-Standards verfügbar machen. Lizenzen und Rechte an den IT-Standards sollten dabei zentral und national geregelt werden.
b) IT-Standards sind nicht bekannt
Standards müssen gut erhältlich sein und in den zuständigen Gremien bekannt gemacht werden. Hierfür benötigt man Schulungen und eine gute Ausbildung der Studenten und Ausbilder. Medizinische Zeitschriften und Fachbücher sollten sich ebenfalls diesem Thema widmen.
c) IT-Standards sind gelegentlich nicht erwünscht
IT-Standards fördern den Datenaustausch und damit letztlich die Transparenz zwischen den Gesundheitsdienstleistern. Sie wirken der Abhängigkeit von proprietären (z. B. Hersteller-spezifischen) Entwicklungen entgegen. In der Entwicklung sind proprietäre Lösungen kurzfristig oft schneller und preiswerter. Um Fortschritte zu erzielen, müssen Standards, wo immer sie verfügbar und anwendbar sind, von den zuständigen IT-Leitern und Behörden in Ausschreibungen eingefordert werden. Patientenvertreter, Ärzte, Krankenkassen, Behörden und politische Organe als Nutznießer der interdisziplinären und intersektoralen Kommunikation und vor allem des Meldewesens sollten Interesse an einer Zusammenarbeit für ein bundeseinheitliches Konzept bekunden und eine gemeinsame Roadmap zur Nutzung von IT-Standards entwickeln.
Wie relevant ist es aus Sicht der Industrie, Krankenhausärzte bei der elektronischen Meldung von Krankheiten softwareseitig zu unterstützen? Bieten Sie bereits entsprechende Schnittstellen und Module für Krankenhausinformationssysteme an? Wie hoch ist die Nachfrage der Kunden?
Oemig: Da die Abgabe der Meldungen eine gesetzliche Verpflichtung für die Ärzte ist, sollte dies so weit wie möglich vereinfacht und evtl. sogar ganz automatisiert werden. Von ORBIS (Krankenhausinformationssystem von Agfa Healthcare) wird dies über entsprechende Formulare unterstützt, die die Ärzte ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben und dann weiterleiten können. Nur leider ist dieser manuelle Prozess mangels besserer Vorgaben - es gibt derzeit nur bundeslandspezifische, papiergebundene Formulare - alles andere als optimal.
Schnittstellen müssen in einer konsentrierten Zusammenarbeit von zentraler Stelle koordiniert und unter Mitwirkung aller Betroffenen auf Basis internationaler Standards definiert werden. Erst dann kann die Industrie interoperable und intersektorale Datenkommunikation ermöglichen. Die vielfach angeführten Portale können als als webbasierte Anwendungen nur temporäre Lösungen sein, weil die Ärzte trotzdem weiterhin alle Daten in Formulare eintragen müssen, so dass die Datenerfassung nicht in ein elektronisches Verfahren integriert ist.
In welchen Bereichen des elektronischen Meldewesens sehen Sie momentan die wichtigsten Hürden?
Krause: Vermutlich besteht die größte Herausforderung darin, dass bei Ärzten, Krankenhäusern, Laboren und Gesundheitsämtern eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Verwaltungsprogramme verwendet werden. Dies erschwert die Entwicklung technischer Standards. Und selbst wenn diese zur Verfügung stehen, wird es sicher viel Aufwand und Zeit benötigen, um die E-Meldung dann auch flächendeckend zu etablieren. Man wird überlegen müssen, wie man die Implementierung bei den Anwendern fördern kann.
Die datenschutzrechtlichen Aspekte sind ebenfalls von größter Bedeutung. Aber mit den heute verfügbaren Technologien und Verfahren sind sie zu lösen.
Thun: In vielen Fällen beschränkt sich das Meldewesen auf bundes- oder landesweite Verfahren. Ein Austausch mit europäischen bzw. internationalen Daten steht oft nicht im Zentrum der Entwicklung und ist daher gar nicht oder nur im Rahmen europäischer Projekte vorgesehen. So besteht die Gefahr der Entstehung von „Datengräbern“ proprietärer Einzellösungen, die einen internationalen Austausch nicht ermöglichen. Gesundheit und Patientensicherheit hört aber nicht an den Landes- oder Bundesgrenzen auf. Für manche Erkrankungen, z. B. Brustkrebs, sind eine Vielzahl von Meldungen erforderlich (Krebsregister, DMP, Qualitätssicherung, Todesursachenbescheinigung, evtl. Unerwünschte Arzneimittelwirkung etc.). Solche Meldungen müssen in ihren Datenelementen und technischen Strukturen aufeinander abgestimmt werden. Dadurch kann nicht nur die medizinische Dokumentation der Ärzte verbessert werden; die systematische Verwendung gleicher Standards leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Entbürokratisierung bei der notwendigen Dokumentation. Hierfür müssen die zuständigen Institutionen, die die Datenvorgaben verantworten, kooperieren und kommunizieren. Dieses geschieht heute meines Erachtens noch nicht im erforderlichen Umfang, da in der Regel jede Institution erstmal „ihre Anwendung“ fokussiert und eine gemeinsame Datendefinition für gleiche Datenelemente nicht vorgesehen ist.
Das DIMDI stellt bereits seit Jahren wichtige IT-Standards im Bereich der medizinischen Terminologien zur Verfügung. Diese können zentral über die Internetseiten des DIMDI abgerufen werden. Zusätzlich benötigte Vorgaben, v.a. für die Syntax und die Semantik, könnten in vergleichbarer Form vorgehalten werden. Diese Standards sollten dabei mit den jeweiligen verantwortlichen Organisationen und medizinischen Fachgesellschaften abgestimmt sein. Nur so wird sichergestellt, dass die Vorgaben wissenschaftlich fundiert sind und dem Anwender und der Behörde größtmöglichen Nutzen bringen.
Oemig: Aus meiner Sicht sind vier größere Fragen zu klären:
Wie können die Meldungen sicher transportiert werden?
Wie kann man die Meldungen elektronisch unterschreiben?
Wie funktioniert die Anonymisierung und Pseudonymisierung der Daten?
Wie sollten die Meldungen inhaltlich (Datenelemente und technische Strukturen) aufbereitet sein?
Für den sicheren Transport der Meldungen gibt es bereits eingesetzte Lösungen wie bei dem Prozess DALE-UV, der ursprünglich für den elektronischen Datenaustausch mit Leistungserbringern in der gesetzlichen Unfallversicherung entwickelt wurde. Die Vergabe einer qualifizierten digitalen Signatur setzt formell lediglich das Vorhandensein eines Heilberufeausweises voraus. Für das Verfahren selbst gibt es mit IHE-XDS-SD schon eine Spezifikation der Initiative „Integrating the Healthcare Enterprise (IHE)“, über die beliebige elektronische Dokumente digital signiert werden können.
Die Anonymisierung und Pseudonymisierung stellen auch kein größeres Problem dar, da man identifizierende Daten weglassen oder durch Codes ersetzen kann. Bleibt also nur die inhaltliche Spezifikation, d.h. wie die Meldedetails elektronisch abgebildet werden sollen. In anderen Ländern wird dafür die Clinical Document Architecture (CDA) eingesetzt, die die Grundlage zur Abbildung für beliebige medizinische Dokumente in ein elektronisches Pendant bildet. Anhand einer beispielhaften elektronischen Meldung haben wir hier bereits gezeigt, dass mit derselben Spezifikation die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Länder erfüllt werden können, ohne dass unterschiedliche Implementierungen vorgenommen werden müssen. Damit würde auch die von Fr.Thun angeführte Forderung nach einheitlichen Datenelementen in den Spezifikationen erfüllt und die Integration in vorhandene Anwendungen stark vereinfacht.
Wir würden uns wünschen, dass bei den Vorgaben und Abläufen für das elektronische Meldewesen in Deutschland zukünftig der komplette Kreislauf betrachtet würde - von den Meldevorschriften über die Software bis hin zur praktischen Handhabung der Meldungen. Wir als Hersteller sollten das Regelwerk in einer ausführbaren Form (zum Beispiel in der Programmiersprache Arden Syntax) an einer zentralen Stelle wie dem DIMDI herunterladen können. Da das Experter-Modul (ein System zur Entscheidungsunterstützung) von ORBIS diese "Sprache (Arden Syntax) spricht“, könnten die Ärzte dann maximal in ihrer Verpflichtung zur Abgabe der Meldungen unterstützt werden.
Das Interview führte Beate Achilles im August 2010. Eine Kurzfassung erscheint in der Zeitschrift E-Health-COM 5 | 2010.
Dr. Sylvia Thun
Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI), Abt. Medizinische Klassifikationen
Frank Oemig
Agfa HealthCare GmbH, Solution Manager für Schnittstellen; Mitglied des Standardisierungsgremiums HL7
PD Dr. Gérard Krause
Robert Koch-Institut (RKI), Leiter der Abteilung für Infektionsepidemiologie
Downloads
Weiterführende Informationen