"Wir brauchen Standardisierung und Datenqualität"
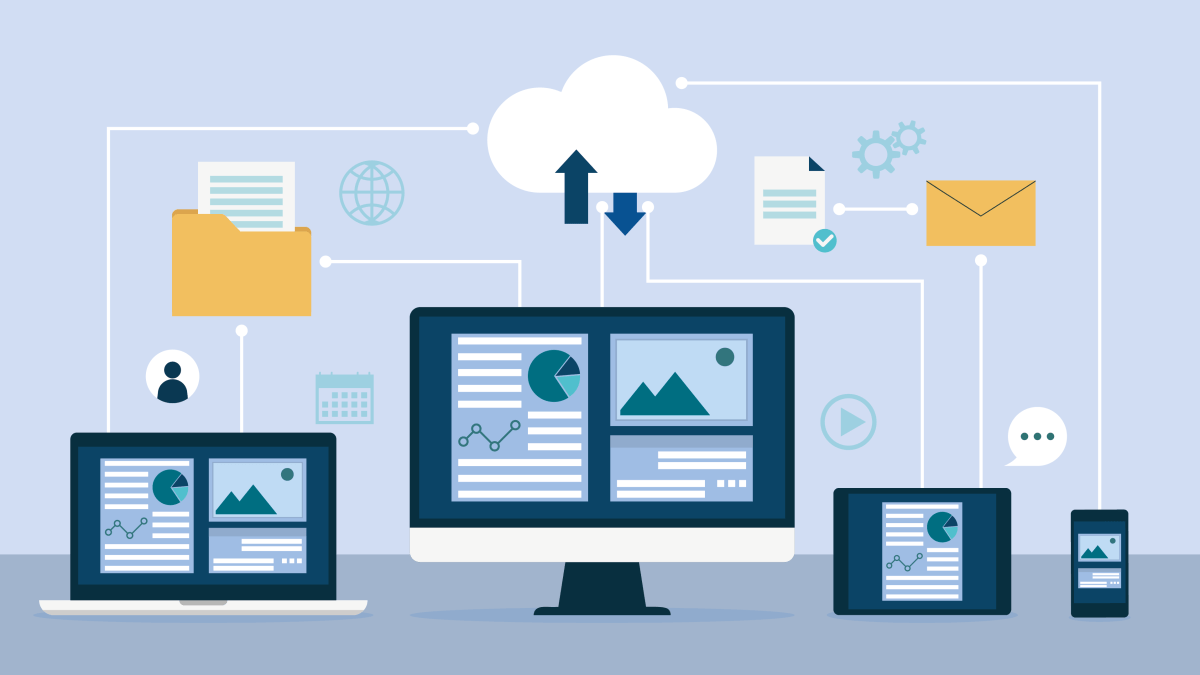
© ST.art - stock.adobe.com
In einem am 17. September 2019 im Aerzteblatt Online erschienenen Interview spricht TMF-Geschäftsführer Sebastian C. Semler über den aktuellen Stand der Medizininformatik-Initative (MII). Er betont neben der Wichtigkeit von Standardisierung und Datenqualität auch die Bedeutung des gemeinsamen Arbeitens an Strukturen und Transparenz, damit der Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Deutschland im Gesundheitsbereich im internationalen Wettbewerb nicht den Anschluss verliert.
5 Fragen an Sebastian C. Semler, Geschäftsführer der TMF – Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung e.V. zum Stand der Medizininformatik-Initiative (MII).

Sebastian C. Semler, Geschäftsführer der TMF. © TMF e.V.
In der vom Bundesforschungsministerium (BMBF) initiierten MII arbeiten die in vier großen Konsortien zusammengeschlossenen Standorte der Universitätsmedizin zusammen mit weiteren Partnern aus Forschung und Industrie seit dem vergangenen Jahr daran, Forschung und Versorgung durch innovative IT-Lösungen zu verbessern und dies anhand von konkreten Anwendungsbeispielen zu demonstrieren. Ziel ist es, den Austausch und die Nutzung von Daten aus der Versorgung sowie aus klinischer und biomedizinischer Forschung über die Grenzen von Institutionen und Standorten hinweg durch den Aufbau von Datenintegrationszentren (DIZ) zu ermöglichen.
DÄ: Was sind zur Halbzeit der aktuellen Aufbau- und Vernetzungsphase die wichtigsten Ergebnisse der MII?
Sebastian C. Semler: Zunächst darf man gar nicht gering schätzen, was es bedeutet, dass inzwischen alle Standorte der Universitätsmedizin in Deutschland an der MII beteiligt sind. Über die Initiative haben wir gemeinsam damit begonnen, einen sogenannten Kerndatensatz aufzubauen und hierfür Daten übergreifend zu standardisieren. Dieser Kerndatensatz ist inhaltlich nicht für ein spezielles Forschungsvorhaben entwickelt, sondern harmonisiert die Bereitstellung von Routinedaten aus der Patientenversorgung über alle Universitätsklinika hinweg, um diese gleichartig für spätere Forschungsfragen nutzen zu können. Wir schaffen damit ein Stück weit den Ausgleich für die große Heterogenität sowohl der Dokumentationssysteme als auch der -gewohnheiten und geben damit einen wesentlichen Impuls für die Standardisierung von Daten. Es ist das erste Mal, dass sich übergreifend bundesweit Institutionen zusammensetzen – dazu gehören mittlerweile nicht mehr nur die Universitätsklinika, sondern auch außeruniversitäre Partner und Vertreter der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und Krankenkassen konnten einbezogen werden,¬ um zum Beispiel das in der MII entwickelte TOP-300-LOINC-Subset zur Kodierung der Laborwerte im internationalen FHIR-Standard zu übertragen, in den gleichen Formaten also, die zum Beispiel künftig auch in den Elektronischen Patientenakten genutzt werden. Die enge Rückkopplung mit der internationalen Standardisierungs-Community ist hierbei ganz entscheidend. Der Kerndatensatz wird sukzessive ausgebaut: Derzeit gibt es sieben Basismodule sowie Erweiterungsmodule, bei denen neben Akteuren aus der Forschung weitere Partner aus der Versorgung einbezogen werden. Zwei Beispiele: Die MII arbeitet zusammen mit dem AKTIN-Notaufnahmeregister, einer vom BMBF geförderten Forschungsplattform, die auch Versorger der Notfallmedizin integriert, an einem Notfall- und Intensivmedizinmodul. Außerdem besteht auch eine Kooperation mit den Krebsregistern und den Comprehensive Cancer Centers, um bereits angewendete Festlegungen aus dem Feld der Onkologie für ein Erweiterungsmodul zu übernehmen. Wir nutzen das, was es schon gibt, und stellen abgestimmte Weiterentwicklungen auch über den Rahmen der Forschung hinaus zur Verfügung.
Zudem gibt es wesentliche Fortschritte im Umgang mit den rechtlichen Rahmenbedingungen. Das betrifft zum einen die weitestgehend ausgehandelte Patienteneinwilligung, zum anderen eine Nutzungsordnung bis hin zu Mustern für Nutzungsverträge, die übergreifend für alle Universitäten nutzbar sein werden und damit auch einheitliche Rahmenbedingungen für alle Akteure definieren. Auf der technischen Seite sind die ersten Datenintegrationszentren an den Standorten eingerichtet und ausgestattet. Den Nutzen und die Machbarkeit der standortübergreifenden Datenzusammenführung hat bereits eine Demonstratorstudie anhand von 1,8 Mio. Patienten mit 3,2 Mio. Datensätzen bewiesen.
DÄ: Die Hightech-Strategie der Bundesregierung sieht vor, bis zum Jahr 2025 an den deutschen Unikliniken eine forschungskompatible elektronische Patientenakte (ePA) zu entwickeln. Wie sieht die Abstimmung der MII mit der KBV aus, die für die syntaktische und semantische Interoperabilität der für die Telematikinfrastruktur entwickelten ePA zuständig ist?
Semler: Die TMF hat sich während der parlamentarischen Beratungen des TSVG sehr dafür eingesetzt, dass die Forschung bei der Festlegung der Inhalte der ePA berücksichtigt wird. Zwischenzeitlich sind wir auf der Arbeitsebene in sehr guten Gesprächen mit der KBV. Klar ist, dass beide Vorhaben gemeinsam gedacht werden müssen, sonst funktionieren sie nicht. Die forschungskompatible ePA ist auf jeden Fall eine große Herausforderung – aus mehreren Gründen. Die Rolle einer ePA ist im Rahmen von Forschung überhaupt erst noch zu definieren. Es ist ein großer Unterschied, ob ich eine versorgerbezogene Akte habe, in die der Patient reingucken kann, oder eine patientengeführte Akte, die vielleicht auch versorgerübergreifend ist. Die Frage „Was ist eine ePA im Versorgungsbereich?“ ist durchaus ein „moving target“. Aus Sicht der Forschung muss das einzelne Informationsobjekt grundsätzlich in der Lage sein, granulare Daten in standardisierter strukturierter Form aufzunehmen. Das wird nicht an jeder Stelle im Versorgungsalltag sofort auszuschöpfen sein. Wir brauchen aber heute den Einstieg in einen schrittweisen Prozess und einen frühzeitigen Dialog.
DÄ: Wie weit sind die Konsortien mit dem Aufbau der Datenintegrationszentren (DIZ)?
Semler: Spätestens bis 2021, dem Ende der jetzigen Förderphase, werden wir den DIZ-Aufbau an den betreffenden Standorten abgeschlossen haben. Damit investiert die MII massiv in die IT-Infrastruktur und den Know-how-Aufbau in der Fläche. Die DIZ werden zukünftig eine wichtige Rolle am einzelnen Klinikstandort spielen, weil sie das Herz der technischen Infrastruktur für eine übergreifende Datennutzung bilden. In den DIZ werden Forschungs- und Versorgungsdaten eines Universitätsklinikums vernetzt und für die Forschung nutzbar gemacht. Außerdem fungieren sie als Kooperationspartner für diverse Forschungsprojekte. Mögliche Beispiele sind die Anbindung von Forschungspraxennetzwerken. Auch innerhalb der Häuser ermöglichen die DIZ eine Zusammenführung von strukturierten Daten aus Subsystemen der Kliniken.
DÄ: Welche Rolle soll künftig die geplante zentrale Antrag- und Registerstelle (ZARS) spielen?
Semler: Die geförderten vier Konsortien (DIFUTURE, HiGHmed, MIRACUM, SMITH) sollen nicht nur wissenschaftlich zusammenarbeiten, sondern auch gemeinsam zu einer funktionsfähigen übergreifenden Infrastruktur beitragen. Dazu müssen sie in der Lage sein, standortübergreifend Daten pseudonymisiert zusammenzuführen sowie deren Auffindbarkeit sicherzustellen. Für die Koordinationsstelle haben wir als TMF im Begleitprojekt die Aufgabe, uns um Letzteres zu kümmern. Die geplante ZARS ist eine übergreifende Plattform, über die alle Standorte angefragt werden können. Sie koordiniert die Datenbereitstellung und ist sowohl ein zentrales Portal für die Datennutzer als auch Registerstelle der Forschungsanfragen. Stellt ein Forscher z.B. eine Feasibility-Anfrage an die ZARS, fragt diese über den einheitlichen Metadatenstandard bei den DIZ die Datenverfügbarkeiten ab und gibt Fallzahlen zurück an den Anfragenden. Das ist ein enormer Mehrwert für den Forschungsstandort im internationalen Wettbewerb. Im Grundsatz ist die ZARS ein reines Anfrageportal, dort werden keine Daten gehalten, die Daten verbleiben an den Standorten.
Zusätzlich soll das Portal auch ein internes Qualitätsmanagement ermöglichen, um etwa nachzuvollziehen, welche Datenanfragen gestellt und wie sie bearbeitet worden sind. Aber auch die Transparenz ist ein wichtiges Thema. So sollen insbesondere die Patienten darüber informiert werden, wozu mit welchen Daten geforscht wird und welche Ergebnisse erzielt worden sind.
DÄ: Woran hakt es noch bei der Konsentierung der Patienteneinwilligung?
Semler: An sich stehen wir mit einem bundeseinheitlich abgestimmten und modularen Mustertext für die Patienteninformation und Einwilligungserklärung sowie einer Handreichung für die Standorte und einem Erklärvideo in den Startlöchern. Die Abstimmung mit der in Deutschland zersplitterten Landschaft der Datenschutzaufsichtsbehörden gestaltet sich allerdings extrem zeitaufwendig. Wir wenden viele Ressourcen für diesen wichtigen vertrauensbildenden Prozess auf. Wir arbeiten seit anderthalb Jahren an einem entsprechenden Konzept, das wir unter anderem auch umfangreich mit den Ethikkommissionen des Arbeitskreises der medizinischen Ethikkommissionen Deutschlands abgestimmt haben.
In der Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder gibt es nun noch Auffassungsunterschiede etwa im Hinblick auf die rechtliche Frage, ob mit der Einwilligung in die Nutzung einer Biomaterialprobe auch das Eigentum an der Probe mit übertragen werden kann oder nicht. Ersteres ist heute eigentlich die etablierte Praxis, die auch von den Ethikkommissionen empfohlen wird und die zudem das Widerspruchsrecht der Patienten mit Bezug auf die Datennutzung in keiner Weise einschränkt. Wir gehen diese Auslegungsfragen konstruktiv an und üben keine datenschutzrechtliche Fundamentalkritik, auch wenn vielfach gar nicht landesgesetzliche Unterschiede, sondern unterschiedliche Interpretationen übergeordneter Gesetzeslagen Gegenstand der Diskussionen sind. Insgesamt scheint aber der gegenwärtige Abstimmungsprozess mit achtzehn unterschiedlichen Aufsichtsbehörden für dynamische Prozesse nicht tauglich.
Dieser Diskurs steht zudem merklich im Kontrast zu der großen Bereitschaft der Bevölkerung, Daten für medizinische Forschung zur Verfügung zu stellen. Die Ergebnisse einer von uns beauftragten repräsentativen Forsa-Umfrage vom August sind eindeutig: 4 von 5 Deutschen wollen ihre Daten zur Verfügung stellen, damit medizinisch geforscht wird.
Für Forschung, die personenbeziehbare Daten aus dem Gesundheitswesen betrifft, müssen wir deshalb dringend zwei Punkte in Deutschland klären: Wir brauchen erstens Standardisierung und Datenqualität, und zwar bis in die Dokumentation hinein, um mehr Nutzen und Erkenntnisgewinn erzielen zu können. Davon profitieren im Übrigen auch die Prozesse in der sektorenübergreifenden ärztlichen Versorgung und die Patientensicherheit unmittelbar. Zweitens müssen wir gemeinsam an unseren Strukturen und an der Transparenz arbeiten, um die Akzeptanz für eine vertrauenswürdige Nutzung von Gesundheitsdaten zu erhalten und zu erhöhen. Dies ist auch wichtig, damit im Gesundheitsbereich der Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Deutschland im internationalen Wettbewerb nicht den Anschluss verliert.


