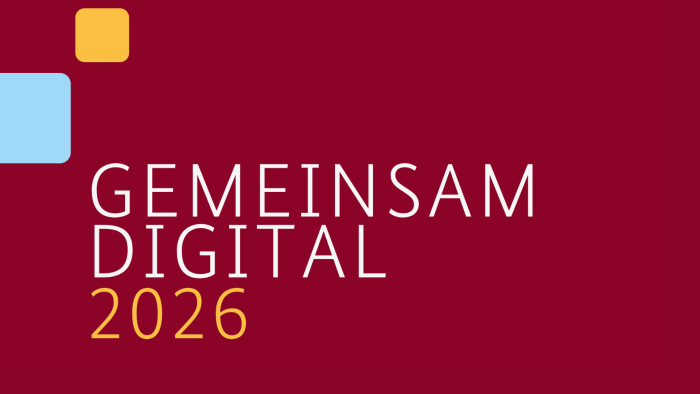Herausforderungen und Chancen der Medizinforschung in Deutschland

Prof. Dr. André Scherag, Direktor des Instituts für Medizinische Statistik, Informatik und Datenwissenschaften am Universitätsklinikum Jena. © TMF e.V./Volkmar Otto
Über die Herausforderungen und Chancen der Medizinforschung in Deutschland haben wir mit Prof. Dr. André Scherag gesprochen. Er ist Direktor des Instituts für Medizinische Statistik, Informatik und Datenwissenschaften am Universitätsklinikum Jena, Mitglied des Nationalen Steuerungsgremiums der Medizininformatik-Initiative (MII) und TMF-Vorstandsmitglied. Unter anderem geht er darauf ein, welche Rolle Künstliche Intelligenz (KI) in der Medizin spielen wird, warum Translation wichtig ist und welche Voraussetzungen für medizinische Spitzenforschung geschaffen werden sollten.
Wie steht es um den Forschungs- und Innovationsstandort Deutschland?
Das ist eine sehr allgemeine Frage – eine differenziertere Sichtweise ist notwendig. Deutschland ist im Bereich der medizinischen Grundlagenforschung sicherlich sehr gut aufgestellt und das gilt auch für potentielle Innovationen, die sich hieraus ergeben könnten. Größere Schwierigkeiten haben wir, die Ergebnisse dieser Forschung in der Translationskette weiterzuentwickeln. Deutschland ist im Bereich der klinischen Forschung bis zur Versorgungsforschung weniger stark aufgestellt – hier gibt es weniger Fördermöglichkeiten und auch im Bereich der Lehre gibt es hier noch „viel Luft nach oben".
Was muss sich ändern oder verbessern, um den internationalen Anschluss nicht zu verlieren und mehr Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung in mehr neue Medizinprodukte, Therapieansätze und somit eine bessere Patientenversorgung zu übersetzen? Welche Forderungen haben Sie an eine neue Regierung?
Es wäre sehr gut, wenn abgestimmte Programme entstehen, die Translationsschritte von der Grundlagenforschung in erste Anwendungen erleichtern. Neben Unterstützung im regulatorischen Bereich sind dies auch praktische infrastrukturelle Hilfen. Man könnte an so etwas wie Translationszentren denken. Wichtig ist jedoch auch, die spätere Translation zu berücksichtigen. Das bedeutet mehr qualitativ hochwertige multizentrische klinische Studien, mehr Beteiligung von Deutschland an internationalen Studien – insbesondere Investigator Initiated Trials (IITs) und Möglichkeiten zu erschaffen, erfolgreiche klinische Studien besser in die klinische Praxis implementieren zu können. Eine Idee könnte hier sein, die Programme des BMBF und der DFG zu klinischen Studien mit dem BMG-Programm im Innovationsfonds Versorgungsforschung zu verbinden. Von daher wäre auch ein Wunsch an eine neue Regierung, dass es wesentlich stärker verschränkte Förderprogramme der einzelnen Ministerien gäbe, die darauf abzielen, nachhaltige Verbesserungen für die Gesundheitsversorgung zu erzielen.
Ist Spitzenforschung im Medizinbereich momentan bzw. in Zukunft überhaupt noch ohne technologische Innovationen/KI möglich?
Auch hier muss eine differenziertere Antwort gegeben werden: Sicherlich ist es so, dass technologische Innovationen/KI in Zukunft alle Bereiche der medizinischen Forschung beeinflussen werden, aber das war bezogen auf technologische Innovationen immer schon so. Mit dem Thema KI bekommt das Thema eine neue Geschwindigkeit und es muss uns gelingen, nur praxisnahe und vielschichtig validierte Systeme in die Praxis zu bringen. Neben der Beachtung regulatorischer Aspekte meine ich dabei auch, dass Spezifika des jeweiligen Gesundheitssystems abgebildet werden müssen.
Wie verändert KI die Medizin der Zukunft, welche Chancen und Grenzen sehen Sie?
Hierzu kann man nur Beispiele geben: KI-Systeme werden dazu beitragen, dass zukünftige Krankenhausinformationssysteme wesentlich weniger davon abhängig sind, wie viel Personen manuell dokumentieren. Es ist zum Teil jetzt schon möglich, über Spracheingabe nicht nur die Arztbriefschreibung, sondern auch die strukturierte Erfassung von Daten zu ermöglichen. Der Einfluss von KI in der Bildgebung ist bereits allgegenwärtig und wird auch weiter Fortschritte machen, z. B. wenn diese multimodaler wird. Das bedeutet, dass nicht nur aus Radiologiebildern selbst Befunde erstellt werden, sondern andere Datenquellen beispielsweise aus der Anamnese der Patientin/des Patienten zu einer Verbesserung der Diagnose über die KI beitragen werden. Grenzen der KIs sind sicherlich immer dort zu sehen, wo man zu sehr auf die Ergebnisse der KI vertraut. Beispielsweise wenn die KIs nicht ausreichend in der Praxis evaluiert wurden.
Was braucht es für Rahmenbedingungen, um das volle Potenzial von KI für die Forschung voll ausschöpfen zu können?
Auch hier kann eine Antwort nur bestimmte Aspekte streifen: Anfangen kann man bei gesetzlichen Rahmenbedingungen, die den Einsatz von KI für die Forschung erleichtern können. Hier ist mit dem GDNG ein erster wichtiger Schritt gemacht, der jedoch voraussetzt, dass auch die technische Infrastruktur zur sicheren Datenverarbeitung zur Verfügung steht. Es ist dringend notwendig, dass diese Infrastrukturen entstehen und auch personell nachhaltig unterstützt werden. Auf diese Weise kann möglichst vielen Forscherinnen und Forschern ein einfacher Zugang zu Gesundheitsdaten unter Beachtung des Datenschutzes und unter Wahrung der IT-Sicherheit gewährt werden. Weitere Voraussetzungen hierfür sind jedoch auch die Qualifizierung der Forscherinnen und Forscher für den Umgang mit diesen Daten, ein wesentlich breiteres methodisches Verständnis von Daten sowie die Verbesserung der Datenqualität selbst.
Ermöglicht KI eine schnellere Translation von Erkenntnissen aus der Grundlagenforschung in die Gesundheitsversorgung?
Sicherlich gibt es Beispiele für spezifische KIs, die eine schnellere Translation von Erkenntnissen aus der Grundlagenforschung in frühe Anwendungen beschleunigen können. Beispiele hierfür sind schnellere Suchen nach Zielstrukturen, an die neuartige Medikamente angreifen könnten, sowie die potentielle Abschätzung von Wirkungen und Nebenwirkungen durch KIs. Auf der Basis dieser Abschätzung können dann gezielt erste Anwendungen entstehen, die entlang der von der KI vorgeschlagenen Wirkung des Medikaments empirische Tests ermöglichen.
Wohin geht es in der medizinischen Forschung? Welche Schwerpunkte sehen Sie für die Zukunft? Und was bedeutet das für die Patientenversorgung?
Auch für die medizinische Forschung gilt, dass der demographische Wandel und die sich hieraus ergebenden Folgen bestimmend für die zukünftige Entwicklung sein werden. Es muss uns gelingen, die medizinische Forschung für junge Menschen attraktiv zu gestalten, und wir sollten auch über Möglichkeiten nachdenken, wie wir aktive, ältere Menschen weiterhin einbeziehen können. Dies gilt für die medizinische Forschung und die Patientenversorgung. Wesentlich wird sein, dass man beide Bereiche zukünftig stärker miteinander verschränkt. Es muss uns hierbei gelingen, wesentlich schneller neue Innovationen in klinischen Abläufen und mit Einbeziehung der Patientinnen und Patienten zu testen. Hierbei muss es auch möglich sein, Pseudoinnovationen wieder aus der Versorgung herauszunehmen.
Weiterführende Informationen